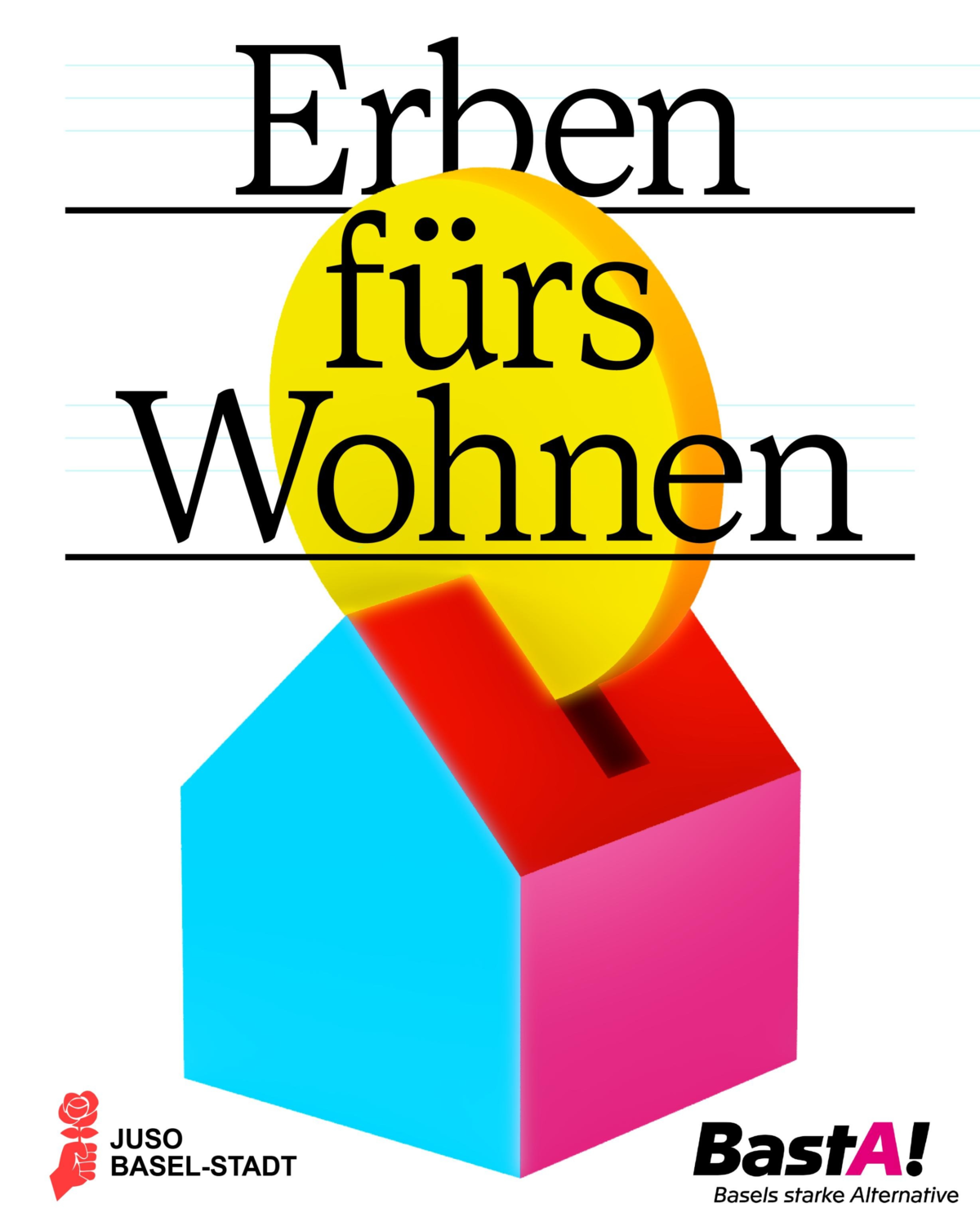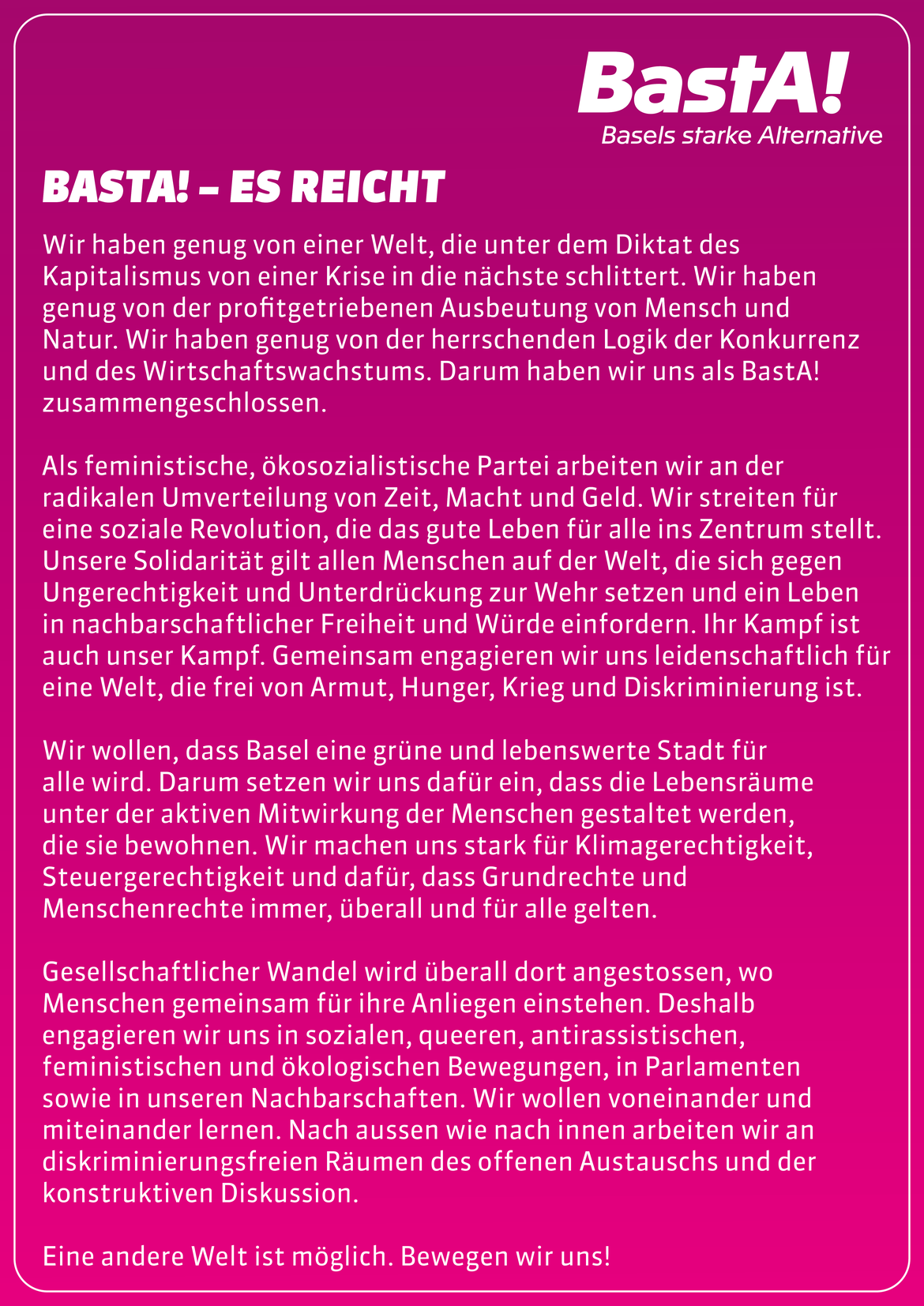Der Reichtum der Schweiz und der Schweiss der Migrant*innen
Von den rund 9 Millionen Einwohner*innen besitzen etwa 2,3 Millionen keinen Schweizer Pass.[2] Sie stellen mehr als ein Drittel der gesamten Erwerbsbevölkerung dar. Besonders arbeitsintensive Branchen – Bau, Hotellerie und Gastronomie, Reinigung, Landwirtschaft sowie Pflege – hängen in grossem Masse von migrantischen Arbeitskräften ab.
Zwischen dem gesellschaftlichen Wert dieser Arbeit und ihrer Sichtbarkeit besteht jedoch ein eklatanter Widerspruch. Migrantische Beschäftigte sind überproportional häufig mit niedrigen Löhnen, prekären Arbeitsbedingungen, Rassismus und Diskriminierung konfrontiert. Die gewerkschaftliche Organisierungsrate liegt bei ihnen deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt: 2022 waren 14% aller Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert, bei Migrant*innen hingegen nur 9%.[3] Besonders migrantische Frauen sind in den Bereichen Hausarbeit, Pflege und Reinigung überrepräsentiert, also in Sektoren, in denen Schwarzarbeit und informelle Beschäftigung weit verbreitet sind.
Migration als strukturelle Zwangslage
Migration ist in den meisten Fällen keine «freie Entscheidung», sondern eine Reaktion auf strukturelle Zwänge. Kriege, Armut, ökologische Krisen, patriarchal erzeugte Ungleichheiten sowie gesellschaftliche Polarisierungen und Repressionen zwingen Millionen Menschen zur Migration. Die Rolle imperialistischer Staaten bei der Produktion dieser Migrationsursachen ist zentral.
Kriege im Nahen Osten und in Afrika, durch neoliberale Politik verschärfte Armut sowie die Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen durch Energie- und Bergbauprojekte gehören zu den wichtigsten Faktoren.[4][5]
Kapitalistische Zentren – auch die Schweiz – tragen einerseits zur Entstehung dieser Krisen bei, während sie andererseits restriktive Migrationspolitiken umsetzen. Gleichzeitig wird migrantische Arbeit als billige Arbeitskraft genutzt, wodurch Lohndumping entsteht, das auch die Arbeits- und Lebensbedingungen einheimischer Beschäftigter unter Druck setzt. In der Folge nehmen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und rechte Bewegungen zu.
Migrantische Arbeit in der Schweiz: zentrale Tendenzen
- Rund 35% aller Beschäftigten in der Schweiz sind ausländischer Herkunft. [4]
- Besonders auffällig ist ihre Konzentration in bestimmten Branchen:
- Baugewerbe: 47% Migrant*innen[5]
- Gastgewerbe und Verpflegungsdienste: 50% Migrant*innen[5]
- Gesundheits- und Pflegewesen: 32% Migrant*innen, insbesondere Frauen[5]
- Landwirtschaft und Saisonarbeit: vor allem aus Osteuropa und Lateinamerika[5]
Darüber hinaus arbeitet etwa ein Fünftel der migrantischen Beschäftigten im Niedriglohnbereich, das heisst mit einem Jahresbruttoeinkommen unter 55’000 CHF.[6]
Hinzu kommt, dass die Zahl der Sans-Papiers in der Schweiz auf 80’000 bis 100’000 geschätzt wird.[7]
Diese Zahlen machen deutlich, dass migrantische Arbeit nicht nur eine tragende Säule der Schweizer Wirtschaft darstellt, sondern zugleich systematisch abgewertet und marginalisiert wird.
Migration, Arbeit und gesellschaftliche Dynamiken
Aus soziologischer Perspektive lässt sich festhalten, dass die Ausbeutung migrantischer Arbeit unmittelbare Auswirkungen auf die gesamte Arbeiter*innenklasse hat. Lohndruck und Verschlechterung von Arbeitsbedingungen treffen nicht nur Migrant*innen, sondern wirken sich gesamtgesellschaftlich aus. In diesem Sinne ist die Verteidigung migrantischer Arbeitsrechte nicht nur ein Anliegen von Migrant*innen selbst, sondern betrifft das Klasseninteresse aller Lohnabhängigen.
Zudem ist die Situation migrantischer Frauen besonders aussagekräftig: Sie befinden sich häufig an der Schnittstelle von Geschlecht, Migration und Klassenzugehörigkeit und erleben dadurch eine «doppelte Ausbeutung». Ihre unsichtbare Arbeit im Care-Bereich verweist zugleich auf die enge Verflechtung von patriarchalen Strukturen und kapitalistischer Ausbeutung.
Darüber hinaus ist Migration auch in ökologischer Hinsicht von Bedeutung. Der Klimawandel, steigende CO2-Emissionen sowie die Zerstörung von Ökosystemen durch extraktive Industrien erzeugen neue Migrationsbewegungen.[5] Insofern lassen sich ökologische Fragen und Migrationsfragen nicht getrennt voneinander betrachten.
Kriege schliesslich wirken doppelt: Sie zerstören Lebensgrundlagen in den betroffenen Regionen und treiben Millionen Menschen in die Flucht; zugleich werden diese Menschen auf den Arbeitsmärkten kapitalistischer Zentren zu prekarisierten Arbeitskräften. Hier zeigt sich die strukturelle Verbindung zwischen Krieg, Migration und Arbeit.
Fazit: Gemeinsamer Kampf und Solidarität
Die Sichtbarmachung, Verteidigung und Organisierung migrantischer Arbeit ist eine zentrale Aufgabe für die gesamte Arbeiter*innenklasse. Selbstorganisation migrantischer Beschäftigter stärkt nicht nur deren Position, sondern erhöht die Kampfkraft aller Lohnabhängigen.Ein gemeinsamer Kampf von Migrant*innen und einheimischen Arbeiter*innen ist die wirksamste Antwort auf Rassismus, Ausbeutung und Spaltungspolitiken. Solidarität ist in diesem Sinne nicht nur moralisch begründet, sondern eine klassenpolitische Notwendigkeit. Migrantische Arbeit ist wertvoll. Sie sichtbar zu machen, ihre Rechte zu verteidigen und durch kollektive Kämpfe zu stärken, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Tuncay Yilmaz,
ehemaliger Co-Vorsitzender der Partei der Sozialistischen Wiedergründung SYKP
Dieser Beitrag ist für das SYKP-Schweiz-Bulletin YENİDEN erstellt worden.
Quellen:
[1] World Bank, GDP per capita, Switzerland (2023).
[2] Bundesamt für Statistik (BFS), Ständige Wohnbevölkerung nach Nationalität (2024).
[3] Unia Gewerkschaft, Gewerkschaftliche Organisierung von Migrant*innen (2023).
[4] BFS, Statistik zur ausländischen Erwerbsbevölkerung (2024).
[5] SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft), Branchenspezifische Arbeitsmarktstatistik (2023).
[6] Caritas Schweiz, Working Poor in der Schweiz (2022).
[7] Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich (SPAZ), Schätzungen zur Zahl der Sans-Papiers in der Schweiz (2023).