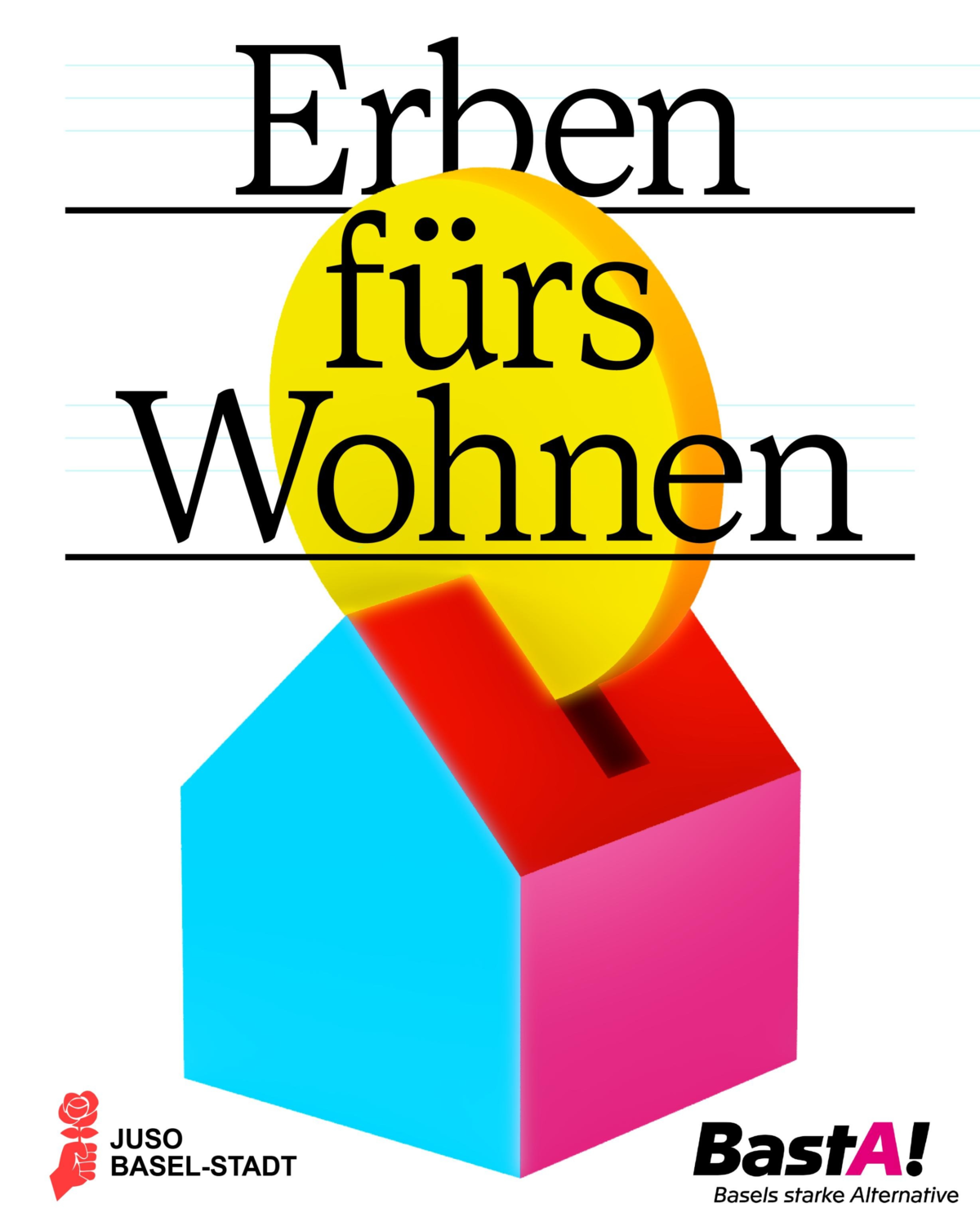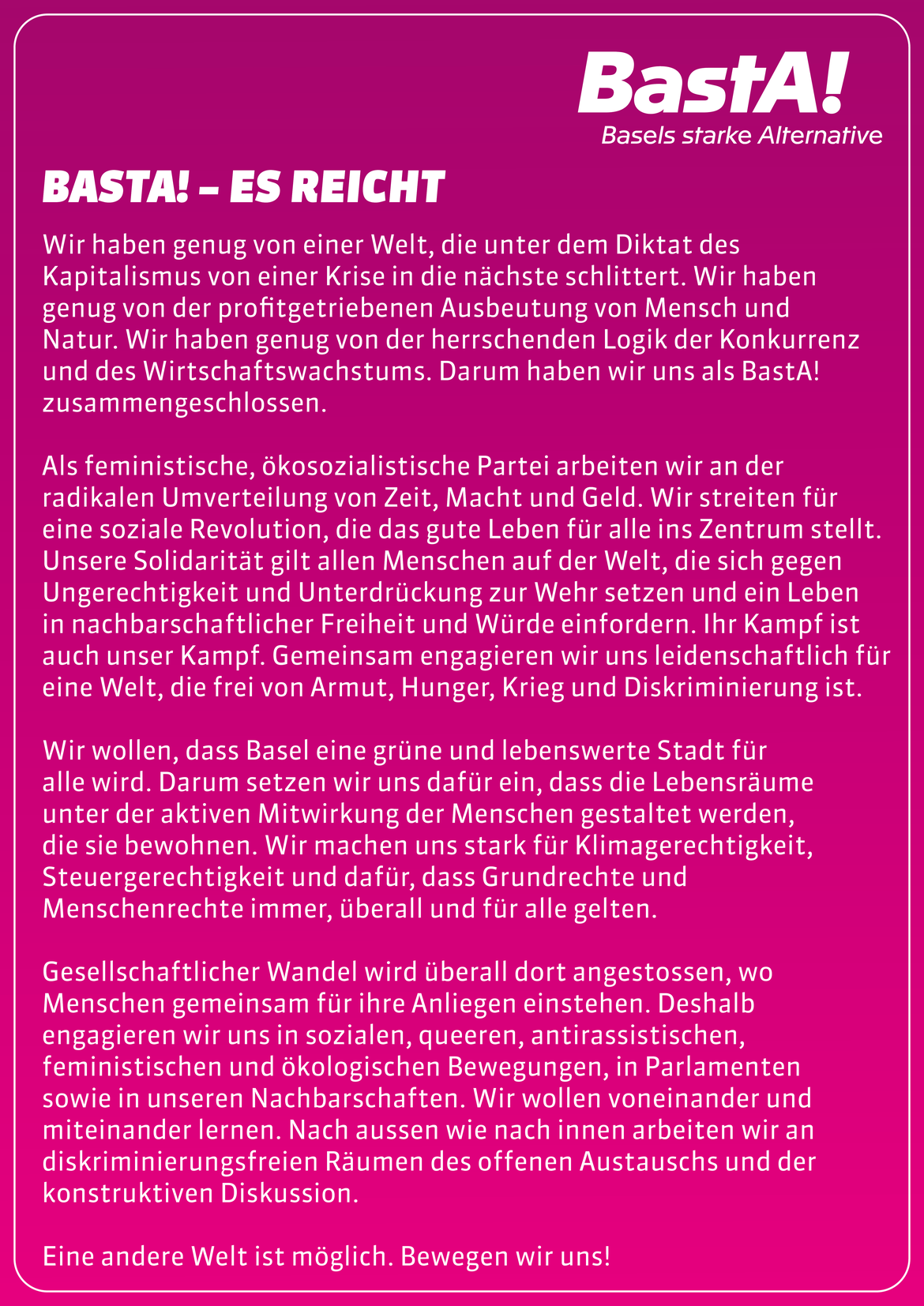BVG-Revision – eine Reform für den Finanzmarkt, nicht für die Menschen

Nach der Rentenaltererhöhung der Frauen soll nun die zweite Säule durch höhere Beiträge und mehr Versicherte saniert werden. «Mit der Reform der beruflichen Vorsorge (BVG 21) sollen das Rentenniveau gesichert, die Finanzierung gestärkt und die Absicherung von Teilzeitbeschäftigten – und damit insbesondere von Frauen – verbessert werden», schreibt der Bundesrat. Doch ist diese Reform der
richtige Weg?
Entgegen der Darstellungen des Bundes führt die BVG-Revision zu tieferen Renten bei Löhnen über 4000 Franken, und auch bei tieferen Löhnen kommt es nur gelegentlich zu Verbesserungen. Wer mehrere Jobs ausübt und dadurch die Eintrittsschwelle übersteigt, bleibt trotz Reform ausgeschlossen.
Zudem bekämpft die Reform die Ursachen von Altersarmut nicht. Sie zieht lediglich die Daumenschrauben derer an, die systemrelevante und schlecht bezahlte Arbeit leisten.
Im Kern ist die Reform eine Stärkung der Broker und des Finanzmarktes. Der k-Tipp schreibt, dass die Pensionskassen von den Einlagen über 20 Prozent für Versicherungsprämien und Verwaltungskosten sowie externe Vermögensverwalter abzweigen. «2022 lagen die Vermögensverwaltungskosten aller Kassen bei rund 6135 Millionen Franken. Dazu kommen rund 752 Millionen Franken, die an Versicherungen bezahlt werden», schreibt der k-Tipp. Das heisst, auf 40 Beitragsjahre fliessen so pro versicherter Person gut 46’000 Franken in die Finanzindustrie statt aufs Alterssparkonto. Es ist also ein riesiges Geschäft mit unserer Altersvorsorge. Darum nimmt die Pensionskassenlobby auch 3,45 Millionen Franken für den Abstimmungskampf in die Hand.
Die Kernelemente der Reform:
• Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6 Prozent
• Der Koordinationsabzug als Sockelbetrag wird durch einen Prozentsatz von 20 Prozent bis 88’200 Franken Jahreseinkommen ersetzt
• Die Eintrittsschwelle wird von 22’050 Franken auf 19’850 Franken gesenkt
• Die Prozente der Lohnbeiträge werden auf zwei Klassen reduziert und prozentual etwas gesenkt, aber real um 9 Prozent erhöht.
Zur Abfederung der heftigen Auswirkungen der Reform wurden einige Ausgleichsmassnahmen für Personen ergriffen, die beim Inkrafttreten der Reform 50 Jahre und älter sind. Hier ist jedoch die Ausnahme fast die Regel:
• die 5 ersten Renten-Jahrgänge nach Inkraftsetzung der Reform: 200 Franken pro Monat
• die 5 nächsten Jahrgänge: 150 Franken pro Monat
• die 5 letzten Jahrgänge: 100 Franken pro Monat.
Die Ausnahmen:
• Wer keine Rente bezieht oder beziehen kann, bekommt keinen Zuschlag. Das betrifft u.a. alle Personen, die nicht mehr aktiv versichert sind und nur über eine Freizügigkeitsleistung verfügen.
• Wer weniger als 15 Jahre in einer Pensionskasse versichert war, bekommt keinen Zuschlag. Das betrifft vor allem Frauen, die jahrelang zu wenig Einkommen hatten, um überhaupt versichert zu sein. Oder Selbständigerwerbende, die sich nur für wenige Jahre einer Pensionskasse angeschlossen haben.
• Schliesslich erhält den maximalen Zuschlag nur, wer die Bedingungen erfüllt und über ein Altersguthaben von maximal 220’500 Franken verfügt.
Am Ende erhalten nur etwa 1,5 Prozent der Versicherten den maximalen Zuschlag und die Hälfte der Versicherten geht gänzlich leer aus, so der Schweizerische Gewerkschaftsbund.
Altersarmut bleibt
Die Reform bindet tiefe Einkommen stärker in die BVG ein. Bei gleichzeitiger Senkung des Umwandlungssatzes für den obligatorisch versicherten Teil führt das jedoch nicht zu mehr Rente. Für viele tiefe Erwerbseinkommen erhöht sich das Einkommen im Alter gar nicht. Sie zahlen zwar (mehr) ein, erhalten aber, wenn sie trotz BVG und AHV auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, nicht mehr Einkommen im Alter. Die Ergänzungsleistungen werden um die Erhöhung der BVG-Rente gekürzt. Diese Personen zahlen also während des Erwerbslebens neu Beiträge an eine Pensionskasse, ohne dass sich damit ihre finanzielle Situation im Alter verbessert, schreibt Michael Graff, ETH, in seiner Analyse zur Altersvorsorge.
Der Zeitdruck ist vorgeschoben
«Mit 156 Milliarden Franken waren die Reserven in der zweiten Säule Ende letzten Jahres mehr als dreimal so hoch wie das Vermögen der AHV», schreibt der k-Tipp. Während Lebensversicherer und Pensionskassen mit unserem Altersguthaben in den letzten Jahren 5,4 Prozent Rendite erzielten, verzinsten sie unser Altersguthaben nur mit rund 2,4 Prozent. Auch der reale Umwandlungssatz der Pensionskassen sank deutlich. Rund 80 Prozent der Versicherten haben eine überobligatorische Versicherung. Dieses Geld ist nicht an den Umwandlungssatz von 6,8 Prozent gebunden, sodass gemäss Swiss-canto der durchschnittliche Umwandlungssatz bspw. für Männer im Alter von 65 Jahren von 6,25 Prozent im Jahr 2015 auf heute 5,31 Prozent gesenkt wurde. Zudem rechnen sie bereits jetzt mit einer höheren Lebenserwartung und tiefen Zinsen. Über diese Mechanismen, die effektiv Leistungs- bzw. Sozialabbau bedeuten, haben die Versicherer aktuell enorme Rückstellungen mit unseren Beiträgen gebildet.
Es braucht eine Lösung, aber eine gute
Das Rentenproblem und besonders der Gender Pension Gap, die Rentenungleichheit zwischen den Geschlechtern, müssen grundlegend angegangen werden. Dafür braucht es eine rentenwirksame Anerkennung unbezahlter Arbeit. Diese Vorschläge existieren. Linke und feministische Gruppen fordern seit langem die Einführung von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften in der zweiten Säule. Schliesslich sind Erwerbsunterbrüche aufgrund von Kinderbetreuung und Sorgearbeit für die Familie von gesamtgesellschaftlichen Nutzen. Es kann nicht sein, dass die Zeche jene zahlen, die diese gesellschaftlich notwendige Arbeit leisten.
Eine Stärkung und eine Erhöhung der AHV auf das verfassungsmässige existenzsichernde Niveau wäre ein weiterer wichtiger Schritt. Das Minimum, was von einer BVG-Revision zu erwarten wäre, wäre auch eine Beschränkung der Mittel, die die Finanzindustrie von unseren Geldern für sich selbst abzwackt. Immerhin vergolden sich die Versicherungen das Pensionskassengeschäft mit bis zu 10 Prozent der Erträge «als Entschädigung für das zur Verfügung gestellte Risikokapital». Es sollte doch erwartbar sein, dass mit so etwas Existenziellem wie dem Renteneinkommen als Teil einer obligatorischen Versicherung, die eigentlich eine Sozialversicherung sein müsste, sorgsam und nachhaltig umgegangen wird.
Franziska Stier, Parteisekretärin BastA!