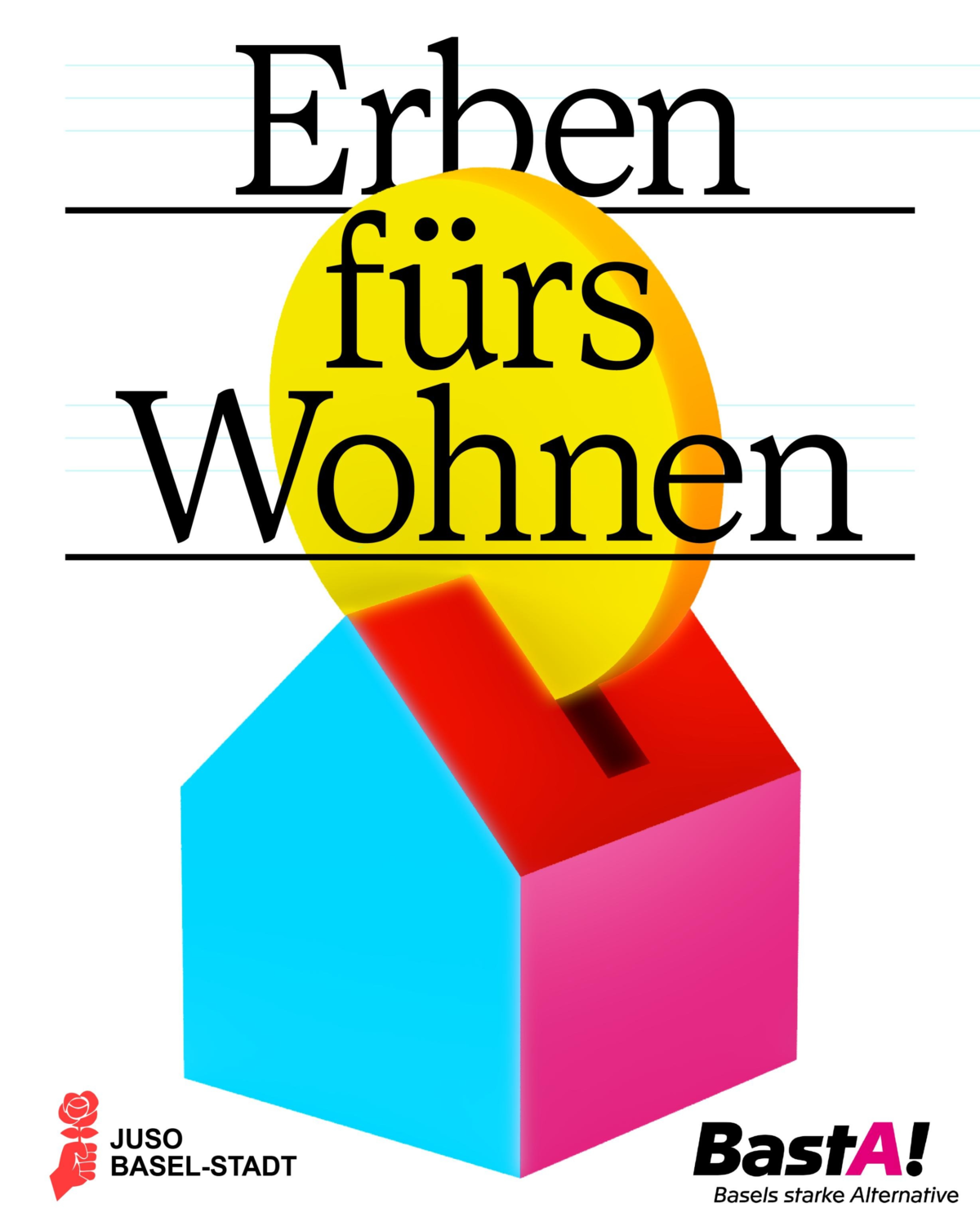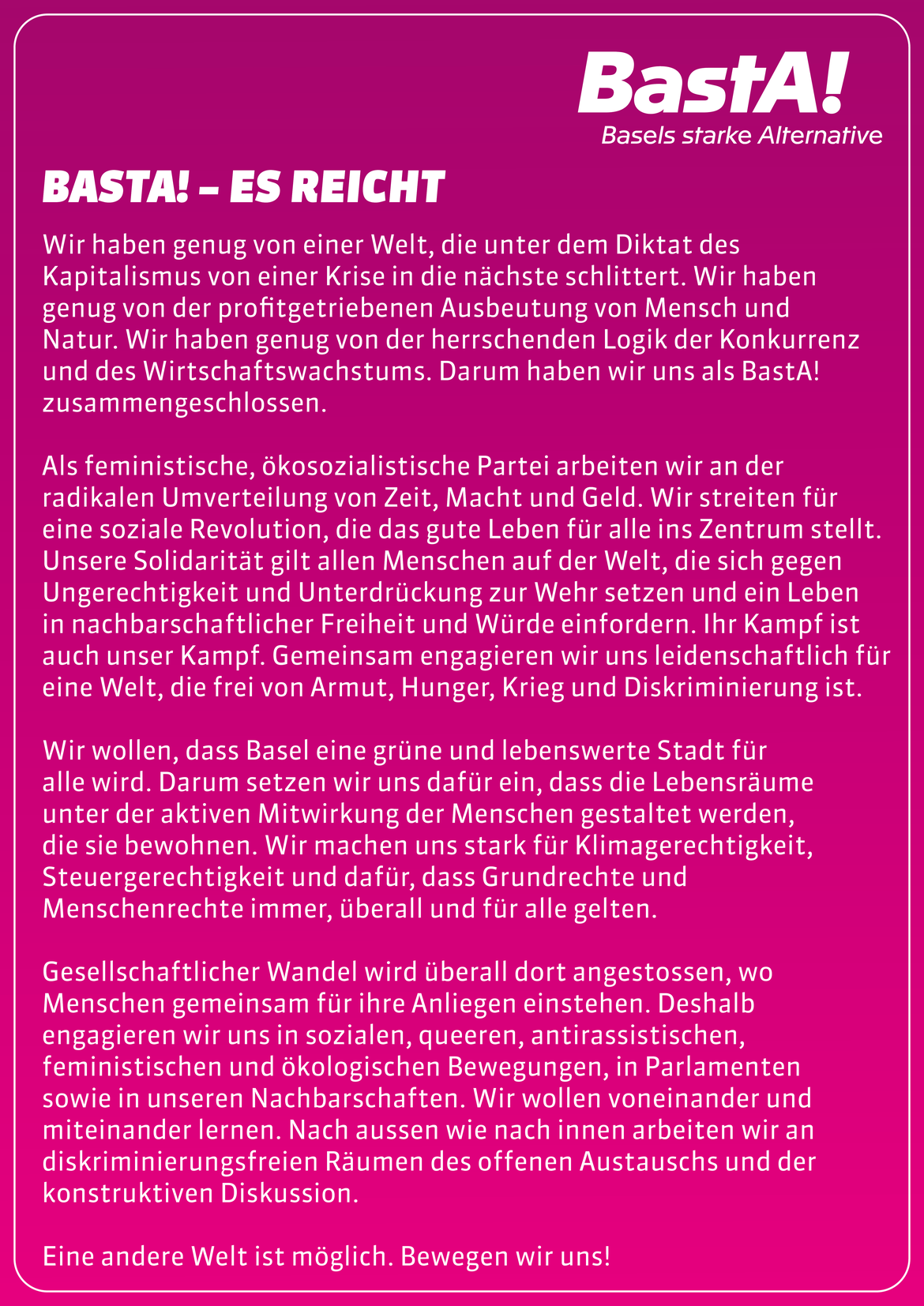1,5 Milliarden Steuergeschenke für Haus- und Wohnungsbesitzende

Seit Jahrzehnten wird in den Bundesparlamenten über den Eigenmietwert (siehe Kasten) gestritten, der dem Hauseigentümerverband ein Dorn im Auge ist. Der Mieter*innenverband hat sich grundsätzlich offen gezeigt für eine Abschaffung des Eigenmietwerts. Aber nur, wenn im Gegenzug alle (!) Steuerabzüge gestrichen werden, von denen Hauseigentümer*innen profitieren. Denn der Eigenmietwert ist der Ausgleich für zahlreiche Steuerbegünstigungen: Wohneigentümer*innen können die gesamten Zinsen der Hypothek auf dem Eigenheim von den Steuern abziehen, während Mieter*innen die Miete nicht von den Steuern abziehen können. Auch Unterhaltskosten, Versicherungen, Renovationskosten, Energiesparmassnahmen und sogar die Grundstückgewinnsteuer bei einem Verkauf der Immobilie können Wohneigentümer*innen von den Steuern abziehen.
Das Parlament hat jedoch beschlossen, den Eigenmietwert abzuschaffen, ohne alle Steuerabzüge zu beseitigen. Weiterhin können Wohneigentümer*innen Steuerabzüge für den erstmaligen Kauf von Wohneigentum, für Energiesparen und Umweltschutz sowie für denkmalpflegerische Arbeiten machen. Damit würden Wohneigentümer*innen gegenüber Mieter*innen noch stärker steuerlich bevorzugt – und die Kantone und Gemeinden mit Steuerausfällen belastet.
Kantonale Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften
Um die Steuerausfälle für die besonders betroffenen Berg- und Tourismuskantone zu reduzieren, will das Parlament ihnen ermöglichen, eine kantonale Steuer auf Zweitliegenschaften zu erheben. Diese würde die wegfallende Eigenmietwertbesteuerung auf Zweitliegenschaften ersetzen. Sie reicht jedoch kaum aus, um die Steuerausfälle ganz zu kompensieren. Zudem ist vollkommen offen, ob die rechtsbürgerlichen Kantonsparlamente diese Steuer tatsächlich einführen würden.
Wir werden am 28. September 2025 also offiziell nur über die Möglichkeit für kantonale Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften abstimmen. Diese Vorlage ist aber gekoppelt an den Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung. Das heisst, um die Abschaffung des Eigenmietwerts abzulehnen, muss man Nein zur Zweitliegenschaftssteuer stimmen.
Massive Steuerausfälle bei Gemeinden und Kantonen
Selbst die bürgerlich dominierte Konferenz der Kantonsregierungen lehnt die Abschaffung des Eigenmietwerts ab und hält die Liegenschaftssteuer auf Zweitwohnungen für keinen genügenden Ausgleich. Der Bund schätzt, dass beim aktuellen Hypothekarzins von durchschnittlich etwa 1,6% Wohneigentümer*innen ungefähr 1,5 Mia. Franken Steuern pro Jahr weniger bezahlen müssen, wobei vor allem Kantone und Gemeinden von den Steuerausfällen betroffen wären. Je tiefer die Hypothekarzinsen sind, desto höher fallen die Steuerausfälle aus.
BastA! positioniert sich gegen die Abschaffung des Eigenmietwerts und empfiehlt deshalb Nein zur Vorlage «Kantonale Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften».
Tonja Zürcher, Vizepräsidentin BastA!
Wie funktioniert die Besteuerung des Eigenmietwerts
Der Eigenmietwert ist ein Naturaleinkommen aus dem in der Liegenschaft investierten Vermögen. Der Kanton schätzt, wie viel Miete man erhalten würde, wenn man die Immobilie vermieten würde. Die geschätzten Eigenmietwerte sind in der Regel wesentlich tiefer als tatsächliche Mieten, weil die Kantone den Eigenmietwert oft konservativ berechnen, um die Steuern für Eigentümer*innen nicht zu hoch werden zu lassen. Der Eigenmietwert muss mindestens 60 Prozent des Wertes betragen, der real als Miete verlangt werden könnte. Diese geschätzte Miete wird als Einkommen versteuert. Im Gegenzug können Hypothekenzinsen, Unterhaltskosten und Versicherungen von den Steuern abgezogen werden.